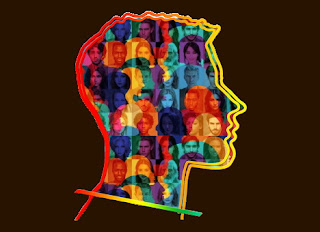Morgens zum Frühstück gibt es Trauben (als Ergänzung zum Joghurt). Und beim Einkauf dieser Tage habe ich eine dunkle Sorte mit besonders aromatischen Beeren erworben. Jede dieser Früchte ist eine kleine Delikatesse, einziges Manko: Sie lösen sich nur widerspenstig vom Stiel. Man muss jede einzelne Beere greifen und vorsichtig abziehen. Aber das Geschmackserlebnis entschädigt für diese kleine Mehrarbeit, der Genuss ist mir wichtiger als die einfache Vorbereitung. Also versuche ich auch nächste Woche wieder diese Sorte zu bekommen (auch wenn die grünen Trauben leichter abgehen).
Übrigens kennen wir das auch von politischen Parteien. Da kann man auch nur ein zusammenhängendes Paket wählen. Da ist dann bei Partei X zwar die Wirtschaftspolitik überzeugend, aber die Aussagen zur Gesundheitspolitik sind mir nicht so recht. Zusammen mit ihrem Antritt zur sozialen Sicherung passt es mir aber insgesamt doch besser als Partei Y, die mit ihrer außenpolitischen Strategie so gar nicht meinen Grundsätzen entspricht.
Ich wähle also – sowohl bei den Trauben (Vorrang für den Geschmack) also auch bei Parteien (Vorrang für Wirtschaft und soziale Sicherung) – eine Kombination von Eigenschaften. Diese Kombination kann ich nicht beeinflussen, ich muss die aus meiner Sicht beste Zusammenstellung wählen.
Die Entscheidung kann man grundsätzlich sehr strukturiert angehen, z. B. Checklisten und Bewertungen für sich erstellen, Entscheidungsmatrizen oder vorbefüllte Bewertungen (z. B. Wahl-o-mat) nutzen. Am Ende ist entscheidend, möglichst alle relevanten Qualitäten zu sehen und für sich selbst individuell zu priorisieren.
Bei den Lebensmitteln ist das noch recht einfach (nur wenige relevante Parameter), beim Parteiprogramm herrscht zumindest theoretisch eine gewisse Transparenz. Viel schwieriger wird es aber bei so komplexen Systemen wie den Menschen um mich herum. Sie haben nicht-abzählbar viele Stärken und Schwächen, die sie mehr oder weniger gesteuert darstellen oder verbergen. Dazu kommt die Schwierigkeit, dass ich erst mal für mich herausbekommen muss, welche dieser Seiten für mich eine Rolle spielen und welche nicht.
Ziehe ich den handwerklich geschickten Kameraden vor, der kaum einen fehlerfreien Satz über die Lippen bekommt? Oder doch lieber einen brillanten Redner, der aber im Haushalt nicht anpackt? Und so weiter.
Was man aus diesen Überlegungen ableiten sollte:
1. Jeder Mensch hat diverse Eigenschaften, Qualitäten, Stärken, Schwächen.
2. Bei den meisten Eigenschaften obliegt es mir, diese als gut oder schlecht einzuschätzen, für mich erwünscht oder unerwünscht, vielleicht hilfreich oder gar nützlich.
3. Ich kann meinen Mitmenschen nur als zusammengesetztes Individuum haben. Dazu gehören zwangsläufig auch von mir eher ungeliebte Seiten.
4. Der Mitmensch verändert sich im Laufe der Zeit, die Zusammensetzung seines Charakters bleibt meist grundsätzlich gleich, aber das Mischungsverhältnis kann wechseln.
5. Ich selbst entwickle mich mit der Zeit; meine Ansprüche, meine Werte und Priorisierung bleiben zwar oft grundsätzlich erhalten, aber die Skalierung kann sich verändern.
6. Wir neigen zur kognitiven Verzerrung, also Überzeichnung von objektiv wahrnehmbaren (positiven, aber auch negativen) Eigenschaften: Wir „steigern uns" in eine Beurteilung.
Fazit: Kaum ein Mensch ist rundum schlecht, aber auch keiner rundum gut. Das Gute am Gegenüber zu schätzen, Veränderungen mitzutragen und zu verstehen, dass jede Medaille zwei Seiten hat, erleichtert ein konstruktives Miteinander. Und wenn jemand plötzlich nicht mehr zu mir passt – liegt das mit einer recht hohen Wahrscheinlichkeit an mir selbst.