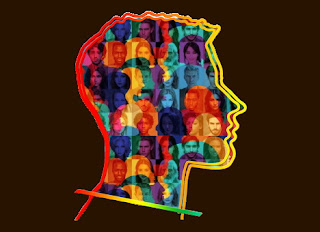Von Zeit zu Zeit steigert man sich in nostalgische Rückblicke. Da erscheint die Jugend als goldene Ära, das Studium ein lockeres Studentenleben und die ersten Jahre im Beruf noch spannend.
Besonders das Telefonieren habe geliebt. Der Apparat stand im Flur der WG, man musste aufpassen, wann er frei war um es dann am viel zu kurzen Kabel bis gerade hinter die Zimmertür zu schleppen. Anschließend in der kleinen Kladde die Einheiten notieren, nein, vorher noch kontrollieren, ob der Vorgänger sein Gespräch eingetragen hatte. Wie lieblos sind dagegen die heutigen Einzelverbindungsnachweise, die Buchführung mit Excel oder gar Flatrates.Ansonsten war es immer so schön, wenn man bei Nieselregen auf dem Fahrrad durch die Straßen fuhr auf der Suche nach einer unbesetzten Telefonzelle. In der allerdings mindestens einer der Groschen (20 Pfg für ein Ortsgspräch) permanent durchfiel. Oder sie war von einem Dauertelefonierer besetzt, der im Trockenen der Zelle vor sich hin plapperte. Nein, ich möchte das wirklich nicht missen, die 24/7-Erreichbarkeit und mein Handy – Verzeihung: Smartphone – ist völlig entbehrlich.
Die Brotauswahl war viel einfacher. Da gab es dunkles Brot, helles Brot und Brötchen, bei unserem Bäcker auch noch Weckchen. Das war das komplette Angebot, man hatte nicht die Qual der Wahl. Am Marktstand gab es kein Obst, bei dem man erst mal recherchieren musste, wie es zu essen ist. Exotisches Gemüse braucht kein Mensch, deutscher Kohl tut es schließlich auch.
Und den möchte ich bei jemand kaufen, der mich kennt. Der über den Dorfklatsch Bescheid weiß, in dem ich natürlich (unfreiwillig) auch eine Rolle spiele. Information gegen Information, ungefragte Beratung in allen Lebenslagen inbegriffen. Und die Wahrheit muss ja nun wirklich nicht immer eine entscheidende Rolle spielen, wichtiger ist das bunte Ausmalen oder auch Streuen von Gerüchten, vornehmlich zu intimen Details.
Was das Kochen angeht, so brauche ich von Gerichten keine Fotos. Die Vorstellungskraft wird gefördert, wenn man zerfledderte Kochbücher ohne Bilder durchliest. Nur Simpel brauchen Chefkoch.de, wo sich aus allen Ritzen der Republik Hobbyköche verbünden und Tipps austauschen. Nein, ich konnte mich immer auf die Empfehlungen meiner Gemüsefrau oder des Metzgers verlassen. Deren kochtechnische Erfahrung war umfassend, ließ sich nicht weiter steigern und duldete keinen Widerspruch.
Doch, doch, das Leben war leicht, insbesondere wenn man an einen bis dato unbekannten Ort fahren wollte. Dafür war Kartenlesen angesagt, Wegbeschreibung austauschen und dann doch verfahren. So konnte man die Gegend kennenlernen oder bei Dunkelheit in verlassenen Orten eine lebende Seele suchen, die einem einen Tipp für die Orientierung geben konnte. Wer braucht ein Navi, wenn man in der Dorfkneipe angetrunkene Bekanntschaften knüpfen kann, die einem vom Weiterfahren abraten: „Da wolln se hin? Da wohnenen nur Iddioden.“
Echtes Highlight waren die Besuche in der Volksbank. Ein strenger älterer Herr schaute mich mit durchdringendem Blick an, wenn ich ein wenig Geld von meinem Sparbuch abheben wollte. „Junge, wofür brauchst du denn das Geld?“ Und: „Wissen deine Eltern davon?“. Ich war mittlerweile erwachsen, aber die fürsorgliche Betreuung des Kundenberaters weiß ich bis heute zu schätzen. Kein schnöder Geldausgabeautomat, der mir ohne zu zucken hunderte Euro ausgibt ohne nach dem Ziel meiner Abhebung zu fragen.
War das nicht alles wundervoll, ach, ich bekomme ganz glänzende Augen bei diesen Gedanken. Ein paar goldene Erinnerungen, schön war sie, die Zeit damals.
[Weitere Blogs: Interdisziplinäre Gedanken, Feingeistiges]